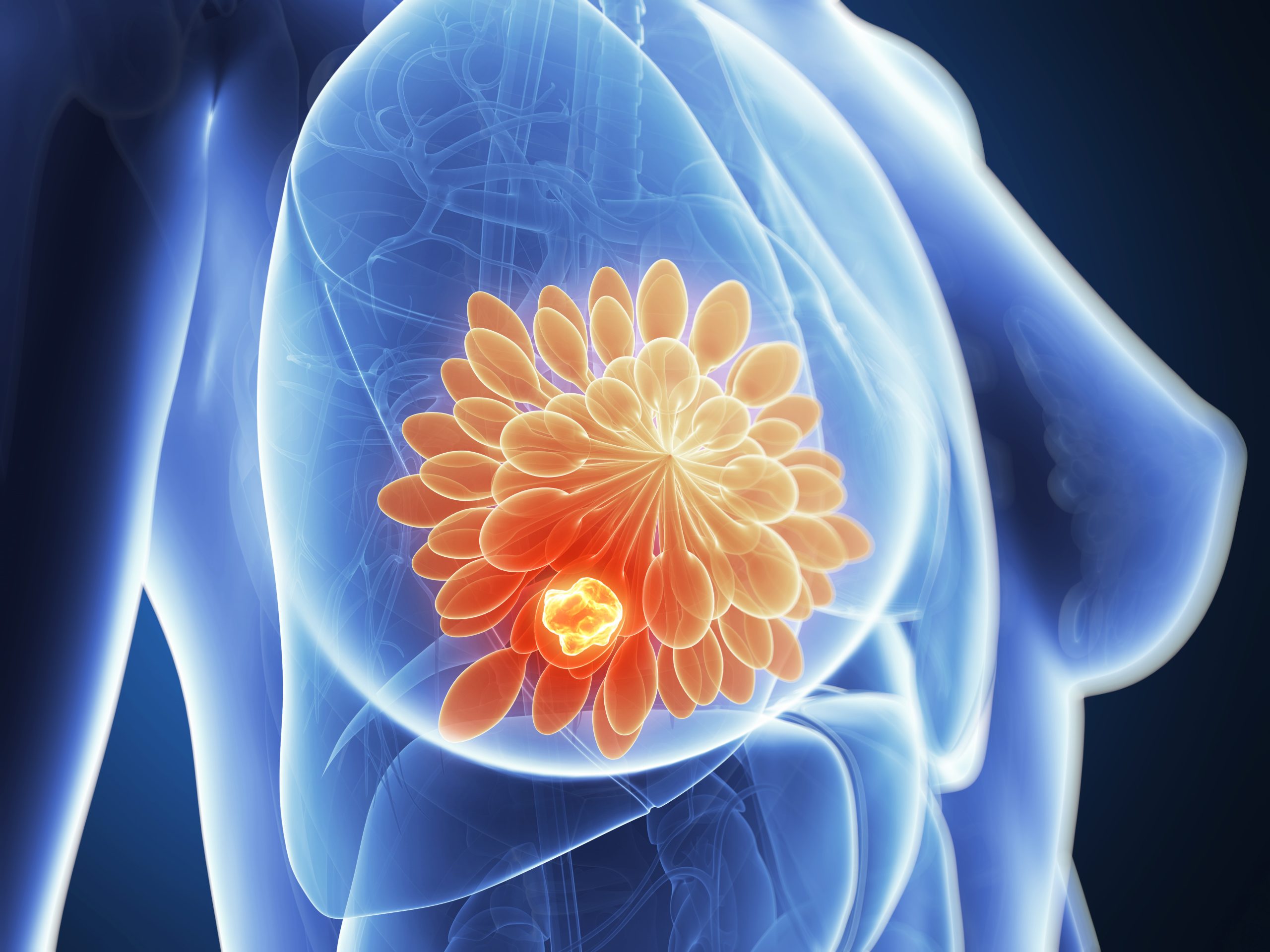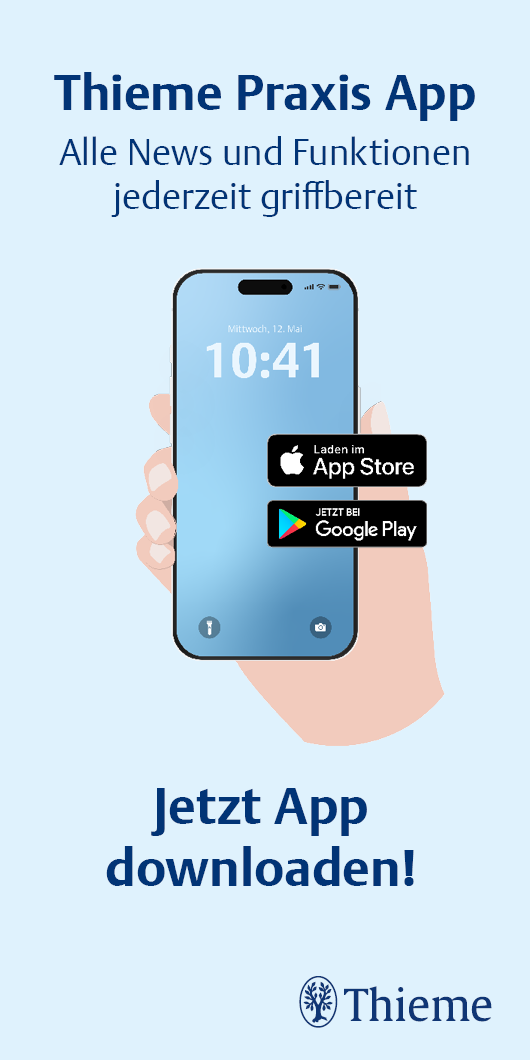Interview
Prof. Dr. Rachel Würstlein vom LMU Klinikum München spricht über neue Ansätze in der Brustkrebstherapie. Im Fokus stehen zielgerichtete Medikamente, digitale Unterstützung und die enge Betreuung der Patientinnen. Jetzt mehr erfahren!

Lesen Sie diesen Artikel kostenlos – mit Ihrem Thieme Account.
Nutzen Sie Ihren bestehenden Thieme Account, um unbeschränkten Zugang zu exklusiven Artikeln zu erhalten. Sollten Sie noch keinen Account haben: Die Registrierung ist kostenlos und verschafft Ihnen Zugang zu vielen weiteren Produkten von Thieme.
Transkript anzeigen
00:05 – 00:44 – Thieme:
Thieme – Drei Fragen an Professorin Doktorin Rachel Würstlein. Sie ist eine führende Expertin auf dem Gebiet der Brustkrebsforschung und Therapie am LMU Klinikum München. Als leitende Oberärztin des Brustzentrums verantwortet sie unter anderem die Studienzentrale, das Molekulare Tumorboard und die Therapie. Planung für Patientinnen mit frühem oder metastasiertem Brustkrebs. Ihre wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf Predictive Marker, zielgerichtete Therapien und Versorgungsforschung.
00:44 – 00:50
Was hat Ihnen Kraft und Motivation für Ihren bisherigen Weg gegeben?
00:50 – 01:22 – Prof. Dr. Rachel Würstlein:
Es ist ja immer im Nachhinein ganz schwer zu beurteilen. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und auch dort die richtigen Personen hatte, die mich gefördert, aber auch gefordert haben. Und das muss man ganz klar sagen, dass es immer beides ist an den Stellen. Ich habe einen ungewöhnlichen Lebenslauf von sehr peripheren Häusern bis jetzt in die Exzellenzuniversität und des CC und habe einfach immer die Chancen wahrgenommen und auch die Weiterbildung gemacht und auch die Fachgebiete besucht, die mich interessiert haben.
01:22 – 01:47
Weil ich glaube, nur wenn das wirklich das ist, wofür man brennt, dann kann man sich da auch investieren. Ich bin so groß geworden, auch durch mein familiäres Umfeld, auch natürlich durch die Prägung der Eltern und anderer wichtiger Personen und habe immer die Sachen gemacht, die mich selbst interessiert haben. Und dann kommt da eben auch die Freude und die Motivation.
01:47 – 02:11
Und am Schluss und das glaube ich, ist wichtig für viele, auch jüngere Kolleginnen und Kollegen ist, sind es die Patienten, die die Motivation sind. Es ist am Schluss irgendwie nichts anderes, wenn man da viel ausprobiert hat. Und das bleibt das Wichtigste da im Gespräch zu bleiben, auch die Verläufe zu sehen und wirklich den Beitrag zu sehen, den man da im individuellen Fall macht.
02:11 – 02:15
Und vielleicht dann, wenn man daran Freude hat, auch in größerem Setting.
02:15 – 02:20 – Thieme:
Was sind aktuelle und zukünftige Forschungen?
02:20 – 02:45 – Prof. Dr. Rachel Würstlein:
Die Forschung ist sehr vielseitig. Also ich bin zum einen natürlich eingebunden in Studiengruppen. Jetzt nehmen wir mal die weg und unsere größte Studiengruppe. Da forschen wir natürlich viel im Bereich neuer, zielgerichteter Therapien und auch Einsetzen schon im frühen Setting, aber auch eben bei neuen Substanzen. Und in den eigenen Forschungen bin ich ja sehr breit aufgestellt in der Versorgungsforschung.
02:45 – 03:08
Da geht es viel um interprofessionelle Zusammenarbeit, also mit der Pflege, mit Ärzten in verschiedenen Sektoren, mit Apotheken und ein anderer Schwerpunkt, der auch eben hier seitens der Klinik kommt, ist sicher auch die Therapie. Begleitung von Patienten mit neuen Ideen wie zum Beispiel Apps oder DIGAS.
03:08 – 03:14 – Thieme:
Was kann man bei internationaler Zusammenarbeit voneinander lernen und abschauen?
03:14 – 03:41 – Prof. Dr. Rachel Würstlein:
Fangen wir mal an mit dem, was ich mir abgeschaut habe oder zumindest glaube. Das ist sicher oft auch im internationalen Kontext dann strukturiertes Arbeiten, auch die Forschung und die eigenen Projekte, so klinisch sie auch bei mir oft sind. Tatsächlich strukturiert voranzubringen. Da eine klare Vision zu haben und sich auch die nötigen Partner und Berufsgruppen und auch andere Ideen einbringen, mit dazuzuholen.
03:41 – 04:07
Ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch eine gute Aufgabenverteilung mit dem jeweiligen Wissen und Können Schwerpunkt mit drin zu haben für das, was sich andere abschauen können. Das ist ja so ein bisschen anmaßend. Ich glaube, ich bin immer sehr nah an den Patienten drangeblieben und es gibt die Möglichkeit, eine sehr klinisch orientierte Forschung auf sehr hohem Niveau zu machen.
04:07 – 04:47
Dafür ist es eben wichtig, die richtigen Partner zu haben, die richtigen Arbeitsgruppen zu haben, aber sich auch zu trauen, eigene Arbeitsgruppen zu machen, eigene Ideen einzubringen und dann das Netzwerk, was man hat, egal ob in einem ganz normalen Rahmen, einer Praxis oder in dem normalen Rahmen einer Klinik oder dann tatsächlich auch in die Forschung. Diese Netzwerke, die man selbst, aber auch die Kolleginnen und Kollegen haben, zu nutzen und da immer sehr breit zu schauen, was gibt es jetzt an interessanten Gesprächspartnern, egal ob jetzt im Moment schauen Richtung KI oder ob im Moment schauen Richtung Patienten, Orientierung.
04:47 – 05:11
Und es ist natürlich ganz wunderbar, wenn man dann an Momente kommt, wo man sieht, Ah, jetzt fügen sich viele Ideen, viele Menschen, die man kennengelernt hat, wieder zu einem neuen Projekt und die Chancen zu nutzen, die sich einem auf dem Weg bieten. Die Chance, in der Förderung, die Chance in der Weiterbildung, die Chance in der Zusammenarbeit und das ist ja dann in das Netzwerk.
05:11 – 05:15
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt in beide Richtungen.
05:15 – 05:29 – Thieme:
Sie, Ihre Einrichtung, Praxis oder Ihr Unternehmen haben Interesse an unserem Format „3 Fragen an…“? Dann schreiben Sie uns für Kooperationsanfragen gerne an Gyn-Community@thieme.de.
Quellen
Thieme Redaktion
Themen in diesem Artikel
Klicken Sie auf ein Thema, um weitere Artikel dieser Kategorie zu sehen.