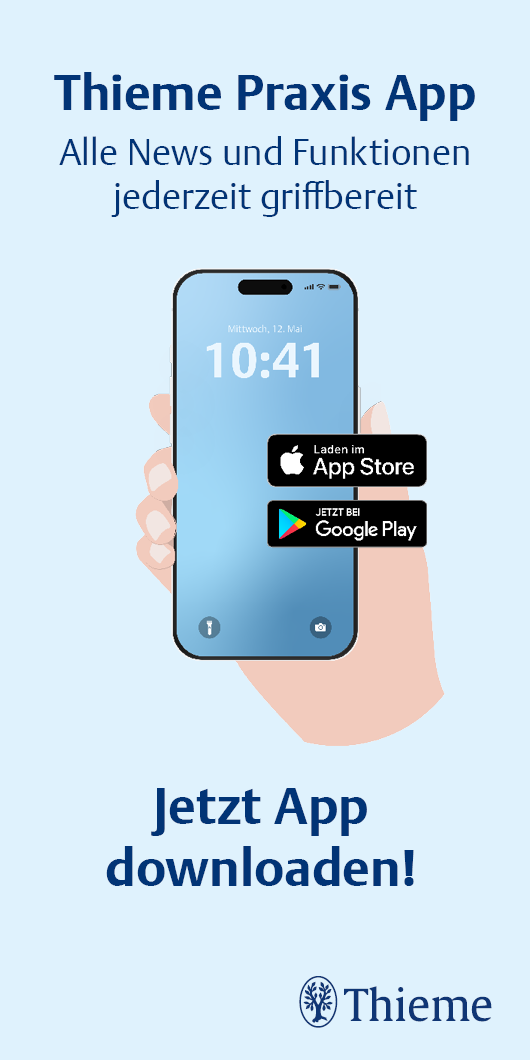Neue Studie zeigt
Autismus entsteht selten durch Gene allein – epigenetische Prozesse sind entscheidend. Eine neue Studie zeigt: Bereits das Körpergewicht der Mutter vor der Schwangerschaft kann die neurologische Entwicklung des Kindes beeinflussen. Forscher fanden epigenetische Veränderungen in der Eizelle, die mit autistischen Verhaltensmustern bei männlichen Nachkommen korrelieren.
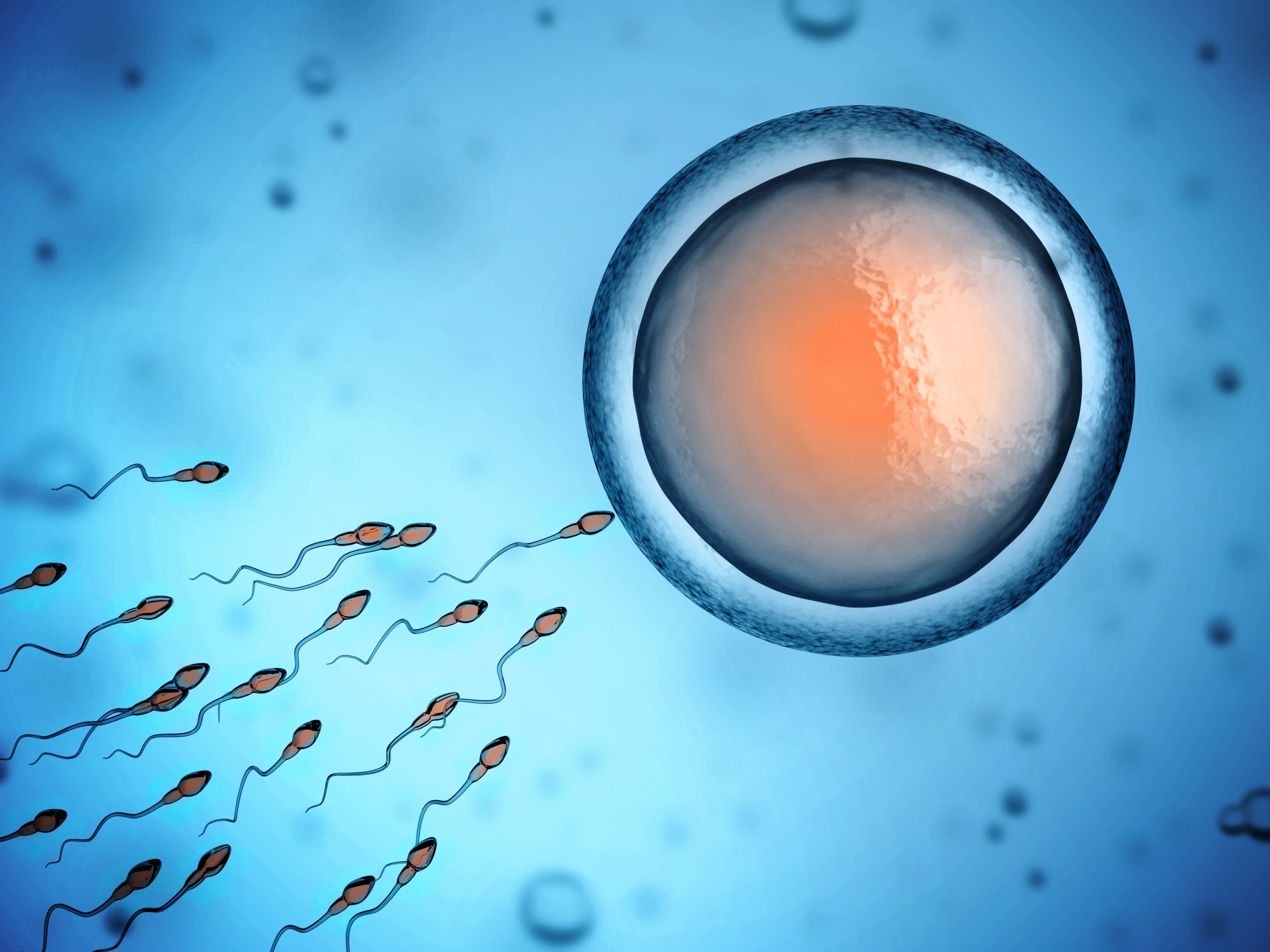
Eine neue Studie zeigt: Das Gewicht der Mutter vor der Schwangerschaft kann das Risiko für Autismus beim Kind beeinflussen. Forscher haben entdeckt, dass bereits die Eizelle epigenetisch vorgeprägt wird, was geschlechtsspezifische Auswirkungen auf die neurologische Entwicklung des Kindes hat. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Zusammenhänge zwischen mütterlicher Gesundheit und Autismus-Spektrum-Störungen.
Genetik spielt nur eine kleine Rolle – Umwelt und Adipositas beeinflussen Autismusrisiko
Nicht einmal 10% der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) lassen sich auf genetische Mutationen zurückführen. Vielmehr haben Umwelt- und epigenetische Einflüsse während der Gehirnentwicklung eine signifikante Rolle in der Pathogenese. Insbesondere Mütter, die vor der Schwangerschaft ein viel zu hohes Gewicht auf die Waage bringen, scheinen ihre Nachkommen einem erhöhten Risiko auszusetzen: Ihre legen im späteren Leben deutlich häufiger ein autistisches Verhaltensmuster an den Tag als Kinder von normalgewichtigen Müttern – wie man seit einiger Zeit weiß. Jetzt hat ein hawaiianisches Forscherteam einen mechanistischen Zusammenhang zwischen der mütterlichen Adipositas vor der Schwangerschaft und autismusbedingten Verhaltensmustern aufgedeckt.
Epigenetische Prägung schon in der Eizelle
Mit dem Ziel, die Auswirkungen einer mütterlichen Adipositas vor der Konzeption mit den Einflüssen während der Schwangerschaft zu trennen, nutzten die Forscher sowohl ein tierexperimentelles In-vitro-Fertilisations (IVF)- als auch ein Embryotransfermodell mit Mäusen. Demnach startet die epigenetische Programmierung – getriggert durch die metabolischen Veränderungen aufgrund des starken Übergewichts – schon früh, schon in der Eizelle. Diese manifestieren sich unter anderem in aberranten DNA-Methylierungsmustern, die in den sich entwickelnden Embryonen weitergegeben werden und letztendlich die Expression relevanter Gene für die neurologische Entwicklung wie Homeer1 beeinflussen.
Veränderte Genexpression und autismusähnliche Verhaltensmuster
Besonders auffällig war die vermehrte Expression einer verkürzten Isoform von Homer1a, die mit einer Beeinträchtigung der synaptischen Funktion in Verbindung gebracht wird. Dies wiederum führt zu Verhaltensweisen, die mit einer Autismus-Spektrum-Störung übereinstimmen. Verhaltenstests an männlichen juvenilen Mäusen zeigten autismusähnliche Phänotypen wie ein beeinträchtigtes Sozialverhalten und repetitive Pflegehandlungen, die an Autismus-Spektrum-Störung erinnern und mit einer veränderten Genregulation im Kortex und Hippocampus korrelieren.
Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Autismus-Spektrum-Störungen
Interessanterweise war dies aber nur bei männlichen Nachkommen der Fall – und nur dann, wenn diese von ihren adipösen Müttern selbst ausgetragen wurden. Wurden hingegen Eizellen normalgewichtiger Tiere in adipöse „Leihmütter“ transferiert, entwickelten sich keine ASS-typischen Verhaltensmuster. Übrigens ebenso wenig wie bei weiblichen Nachkommen. Letzteres spiegele – so die Forscher – die geringere ASS-Prävalenz bei Frauen in der menschlichen Bevölkerung wider.
Schwangerschaftsvorbereitung: Gesundheit der Mutter beeinflusst Kindesentwicklung
„Diese Arbeit zeigt, wie die Gesundheit einer Mutter vor der Schwangerschaft – nicht nur während der Schwangerschaft – die Gehirnentwicklung ihres Kindes tiefgreifend beeinflussen kann“, kommentierte Dr. Alika K Maunakea aus Manoa (Hawaii, USA), die Studienergebnisse in einer Pressemeldung. „Wir waren überrascht, als wir feststellten, dass auch ohne direkten mütterlichen Kontakt nach der Empfängnis diese epigenetischen Prägungen aus der Eizelle genug Gewicht hatten, um das Verhalten zu verändern.“
Wichtige Fragen zu mütterlichem Übergewicht und Autismus-Risiko (FAQ):
Aktuelle Studien zeigen, dass Adipositas der Mutter vor der Schwangerschaft das Autismus-Risiko beim Kind erhöhen kann. Die Forschung hat einen direkten Zusammenhang zur epigenetischen Prägung der Eizelle nachgewiesen.
Die epigenetische Prägung beschreibt Prozesse, die Gene an- oder abschalten, ohne die DNA-Sequenz zu verändern. Das mütterliche Gewicht kann diese Muster bereits in der Eizelle so prägen, dass die neurologische Entwicklung des Kindes beeinflusst wird.
Die Studie hat gezeigt, dass die epigenetischen Veränderungen besonders bei männlichen Nachkommen autismusähnliche Verhaltensweisen auslösen können. Dies spiegelt die höhere Prävalenz von Autismus bei Jungen in der menschlichen Bevölkerung wider.
Ja, die Studie legt nahe, dass die Gesundheit der Mutter auch vor der Schwangerschaft entscheidend ist. Eine ausgewogene Ernährung und ein gesundes Körpergewicht können die epigenetische Prägung der Eizelle positiv beeinflussen.
Genetische Faktoren sind Mutationen in der DNA-Sequenz und für weniger als 10 % der Autismus-Fälle verantwortlich. Epigenetische Faktoren hingegen sind Umwelt- und Lebensstil-Einflüsse, die die Genexpression verändern und eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Autismus spielen.
 Fazit
Fazit
Die Studie liefert wichtige Hinweise darauf, dass die mütterliche Gesundheit bereits vor der Empfängnis langfristige neurologische Entwicklungsverläufe bei Kindern programmieren kann. Angesichts der weltweit steigenden Raten von Fettleibigkeit und Autismus-Spektrum-Störungen könnten diese Ergebnisse neue Wege für frühe Interventionen öffnen – möglicherweise sogar vor der Konzeption. Die Forscher hoffen, dass zukünftige Studien therapeutische Strategien erforschen werden, die diese Effekte durch ernährungsphysiologische oder pharmakologische Mittel umkehren oder abschwächen können.
Von Stephanie Schikora
Themen in diesem Artikel
Klicken Sie auf ein Thema, um weitere Artikel dieser Kategorie zu sehen.