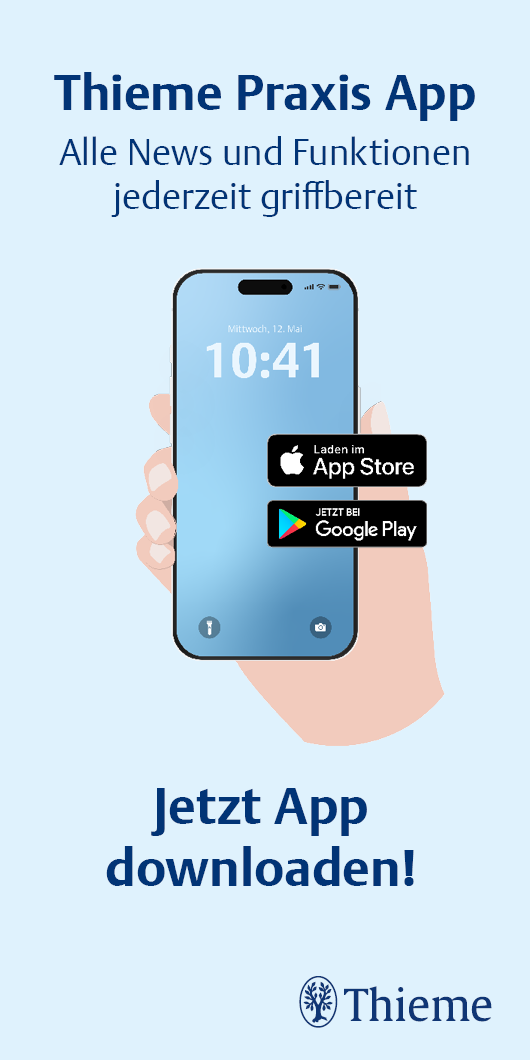Zwischen Glück und Überforderung
Nicht jede Mutter erlebt nach der Geburt nur Glück: Viele kämpfen mit Ängsten, Erschöpfung oder depressiven Verstimmungen. Eine gezielte Mutter-Kind-Therapie kann helfen, die Bindung zu stärken und die psychische Gesundheit zu stabilisieren. Doch spezialisierte Angebote wie Tageskliniken sind selten – und die Versorgungslücken groß, wie Expertinnen und Experten kritisieren.

Inhaltsverzeichnis
Etwa jede fünfte Mutter erlebt nach der Geburt nicht nur Glück, sondern fühlen sich überfordert, hilflos oder haben Schwierigkeiten, eine Bindung zum Kind aufzubauen. Eine gezielte Therapie in Mutter-Kind-Tageskliniken kann dann nicht nur helfen, Ängste und Depressionen zu lindern, sondern gleichzeitig auch die Bindung zum Kind zu stärken. Die positiven Effekte wirken langfristig und verbessern auch das Verhalten der Kinder. Doch solche Angebote stehen nicht flächendeckend zur Verfügung, kritisiert die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und ärztliche Psychotherapie (DGPM).
Die Geburt eines Kindes ist für viele Frauen eines der intensivsten Erlebnisse ihres Lebens – geprägt von körperlicher Verausgabung, aber auch großer Vorfreude. Doch die anfängliche Freude hält nicht immer an: Zahlreiche Mütter kämpfen nach der Geburt mit Ängsten, Erschöpfung oder Depressionen. „Wenn sich Mütter belastet oder alleingelassen fühlen, spürt das auch das Kind“, erläutert Prof. Kerstin Weidner, Dresden.
Gezielte Therapie stärkt Bindung und Selbstvertrauen
In einer umfangreichen Studie hat sie gemeinsam mit Psychotherapeutin Dr. Susann Schmiedgen und ihrem Team 348 Mütter mit psychischen Erkrankungen – darunter Depressionen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen – begleitet. Die Mütter wurden im ersten Jahr nach der Geburt aufgenommen. Im Fokus stand eine im Durchschnitt 32-tägige interaktionsfokussierte Therapie in der Tagesklinik, die nicht nur Einzel- und Gruppensitzungen umfasste, sondern vor allem die Beziehung zwischen Mutter und Kind stärkte. Durch Videoanalysen, spielerische Übungen und gemeinsame Alltagsinteraktionen lernten die Frauen, die Bedürfnisse ihrer Kinder besser wahrzunehmen und zu verstehen, auf ihre Kinder einzugehen und sich als Eltern sicherer zu fühlen.
Langfristige Effekte für Mutter und Kind
Das Ergebnis beeindruckt: Bereits bei Entlassung waren depressive Symptome, Ängste und wahrgenommener Stress deutlich reduziert. Gleichzeitig wuchs das Vertrauen der Mütter in ihre elterlichen Fähigkeiten. „Diese positiven Effekte blieben bis zu einem Jahr nach der Therapie stabil“, berichtet Schmiedgen.
Wichtig ist auch der Blick auf die Kinder: Je besser sich der psychische Zustand der Mutter langfristig entwickelte, desto geringer waren Verhaltensauffälligkeiten bei den Kleinen. „Das unterstreicht die enge Verbindung zwischen mütterlicher psychischer Gesundheit und dem Wohlbefinden der Kinder“, so Dr. Schmiedgen.
Leitlinien sollen Versorgung rund um die Geburt verbessern
Parallel zur Studie in Dresden arbeiten 2 bundesweit geförderte Projekte – PERIPSYCH und PERITRAUMA – unter der Leitung von Weidner daran, wissenschaftlich fundierte Leitlinien für die Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen rund um die Geburt zu entwickeln. Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte sowie Fachkräfte in der Jugend- und Familienhilfe besser darin zu schulen, seelische Belastungen bei Müttern frühzeitig zu erkennen und betroffene Familien gezielt sowie abgestimmt zu unterstützen.
Versorgungslücken: Therapieangebote für Mütter fehlen vielerorts
Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse und Arbeit in diesem Bereich fehlt es nach wie vor an flächendeckenden spezialisierten Angeboten für belastete Mütter. Tageskliniken wie die in Dresden sind deutschlandweit selten. „Wir appellieren deshalb an das Gesundheitssystem, mehr niederschwellige und gezielte Hilfsangebote zu schaffen und ein Screening zu etablieren, um in dieser sensiblen Lebensphase Leiden zu verhindern und Familien nachhaltig zu stärken“, betont Prof. Hans-Christoph Friederich, Heidelberg, Vorsitzender der DGPM.
FAQ zur psychischen Belastung nach der Geburt
Etwa jede fünfte Mutter fühlt sich nach der Geburt überfordert, hat Ängste oder Schwierigkeiten, eine Bindung zum Kind aufzubauen.
Eine interaktionsfokussierte Therapie in Mutter-Kind-Tageskliniken, die Einzel- und Gruppensitzungen sowie praktische Übungen zur Stärkung der Mutter-Kind-Bindung umfasst.
Die Therapie reduziert depressive Symptome und Ängste bei Müttern und stärkt ihre elterlichen Fähigkeiten, was sich positiv auf das Verhalten der Kinder auswirkt – langfristig bis zu einem Jahr nach der Behandlung.
Der psychische Zustand der Mutter beeinflusst maßgeblich das Wohlbefinden und Verhalten des Kindes, da eine sichere Bindung und elterliches Vertrauen die kindliche Entwicklung fördern.
Derzeit fehlen flächendeckend spezialisierte Tageskliniken für diese Therapien in Deutschland; die Angebote sind regional begrenzt.
Empfohlen wird der Ausbau niederschwelliger Hilfsangebote, das etablierte Screening psychischer Belastungen in der sensiblen Zeit nach der Geburt und eine bessere Schulung von Fachpersonal.
Die bundesweiten Projekte PERIPSYCH und PERITRAUMA entwickeln Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen rund um die Geburt, um Fachkräfte besser zu qualifizieren.
FAQ Thieme Praxis: Antworten auf alle wichtigen Fragen zu unserem neuen Angebot
Themen in diesem Artikel
Klicken Sie auf ein Thema, um weitere Artikel dieser Kategorie zu sehen.